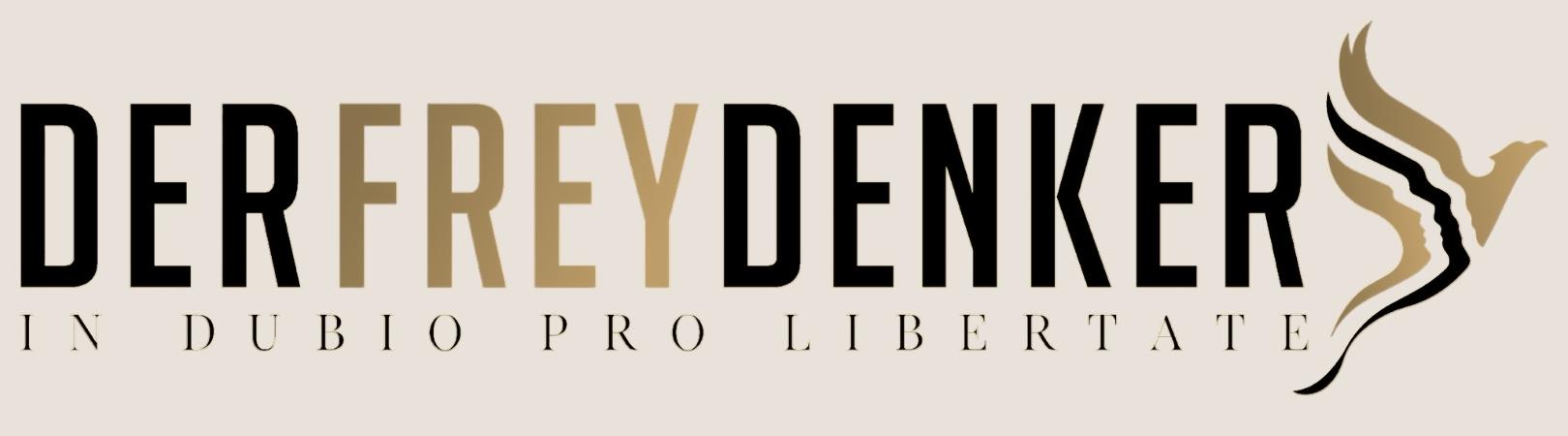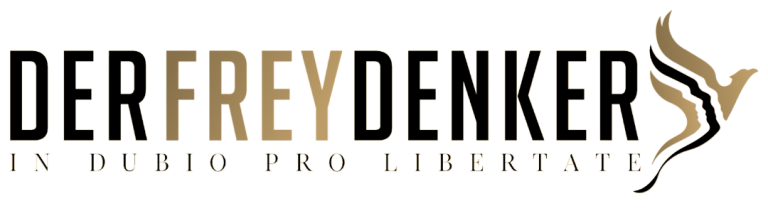Die Wohnungssuche als Student im heutigen Berlin gleicht einer griechischen Tragödie. Der Held strotzt am Anfang vor Kraft und Selbstüberschätzung. Er will nicht nur eine Wohnung, er will eine schöne Wohnung. Er will nicht viel zahlen, nicht weit fahren, will eine Veränderung, aber trotzdem nah an seinen Lieblingsplätzen residieren. Er will Ruhe und trotzdem in einem aktiven und belebten Kiez wohnen. Er will es bunt haben und trotzdem nur nette, angenehme und wohlerzogene Nachbarn neben sich wissen. Er will eine niedrige Kaution und eine keine Wünsche offen lassende Einbauküche; eine Altbauwohnung und trotzdem ein großes Bad mit Wanne. Er will, das muss man wissen, das Unmögliche.
Er muss geläutert werden, indem er vom Schicksal in eine tiefe Existenzkrise gestürzt wird, aus der er sich nur befreien kann, indem er das tut, was er ursprünglich auf jeden Fall vermeiden wollte: zu teuer zu wohnen. So erging es auch mir, drei quälende Monate lang auf dem nun schon berühmt-berüchtigten Wohnungsmarkt Berlins. Aber es waren auch erkenntnisreiche Wochen. Über das Schuhe-Ausziehen in schlecht gelüfteten WGs, das Bittstellertum gegenüber Wohnungsgesellschaften, die nichts mehr leisten müssen und um die man sich trotzdem bemühen muss, über astronomische Preise und enttäuschte Erwartungen.
Mit nassen Füßen in schmuddeligen Berliner Altbauwohnungen
Um die Geschichte zu verstehen, muss man wissen, wie es in Berlin einmal war. Früher, da war nicht nur alles besser, sondern in Berlin auch alles günstiger. Das diese Zeiten nicht ewig anhalten würden, war eigentlich jedem klar, der vor der deutschen Binnenmigration, vor allem der prenzlschwäbischen, in den letzten Jahren nicht die Augen verschloss. Und da wir ja von Horst Seehofer wissen, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist, stellte das die bisherigen Wohngesetze in Berlin auf den Kopf. Früher, zu meinen Schulzeiten war es doch so: Im Westen Berlins, soll heißen in Charlottenburg, Wilmersdorf, Steglitz, Zehlendorf, Lankwitz usw. wohnte das gutsituierte Bürgertum. Ja, das gibt es in Berlin tatsächlich. Auch wenn es in Berlin keine Lobby hat und nur unter Auflagen geduldet wird. In Berlin ist ein Konservativer fast ein Oxymoron. Ich beschreibe es gern so, dass ein Konservativer in Berlin für einen Bayer schon ein lupenreiner Sozialdemokrat ist, während ein Sozialdemokrat aus Bayern in Berlin noch ein erzkonservativer Reaktionär wäre.
In Berlin ist man als Bürgerlicher offen und liberal. Man schätzt die „Diversität“ dieser „großen Stadt“, hier sei einfach „immer etwas los“, die Stadt „werde nie langweilig“, außerdem erfreue man sich an den vielen Kulturen Kreuzbergs. Man ist ja pro Flüchtlinge, schließlich hat man Vorfahren aus Pommern, man geht ins kritische linke Theater und klatscht beim politischen Kabarett zu den antiamerikanischen Witzen. Nach so viel Klassenkampf und antikapitalistischer Revolte fährt man zurück in sein Villenviertel in Dahlem oder in den Grunewald und gießt seinen Vorgarten, sorgt sich um den Glanz der Mercedes S-Klasse oder eines SUV des persönlichen Geschmacks. Man setzt sich selbstredend für Chancengleichheit in der Gesellschaft ein, die eigenen Kinder jedoch schützt man vor zu viel schlechtem Umgang und hält die Gymnasien, auf denen bereits die eigene Familiendynastie das Abitur ablegte, auffällig ausländer- und niedriglohnsektorfrei. Dafür hält man als Ehrenvorsitzender des Fördervereins der Elternschaft glühende Reden für Integration und Bildungsfreiheit, man schätzt den „Beitrag, den auch wir dazu mit unserer Schule leisten“. Integration gelingt in Berlin besonders dann gut, wenn die Einwandererquoten aus fremden Kulturen und einkommensschwachen Schichten unter 10% liegen und die Schülerschaft zu 90% schön weiß, protestantisch und wohlerzogen ist. Soweit, so klar. Deshalb waren die Mieten in West- und vor allem Südberlin hoch und die Mieten im Osten Berlins sowie im Schmuddelviertel Kreuzberg, in Neukölln, Moabit, Wedding und Prenzlauer Berg günstig. Dort lebten nur die Spinner, die Künstler und die alten Anarchos und Hausbesetzer der früheren Sponti-Szene und der Wehrdienstverweigerer. Und natürlich nicht zu vergessen, die Ausländer.
Seitdem die Prenzelschwaben aber die günstige Preislage für sich als Altersanlage entdeckten und deren Eltern dem jungen Pärchen das Leben in der freieren Stadtluft finanzierten, damit diese im Bio-Szene-Cafe der Stuttgarter Sozialkontrolle entfliehen konnten, ging es bergauf mit Ost-Berlin.
Prenzlschwaben, soziale Vermieter und sinkende Ansprüche
Auf einmal kehrten sich die Vorzeichen um. Chinesen, Araber und Russen kamen dazu und kauften in großen Wellen, vor allem nach der Finanzkrise, sicheres Betongold in der deutschen Hauptstadt. Dazu spielte sich nach und nach die Startup-Szene Berlins, seit jeher mehr Schein als Sein, als die Innovationskraft der nächsten Jahre auf. Durch kreative Innovationen, wie vegane Kondome in Regenbogenfarben, sei die Zukunft der deutschen Wirtschaft ab sofort hier zu suchen. Die Politiker, die Medien und die Investoren stürzten sich auf die überteuerten Nichtsnutze und finanzieren seitdem eine der größten Blaßen der Bundesrepublik.
Will man jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer Berg oder Gott behüte, in Kreuzberg ergattern, kommt dies dem Wunsch nach dem Gewinn eines Euro-Lotto-Jackpots gleich. Zahlte man früher für so ein Etablissement vielleicht 500€ warm, wenn überhaupt, so ist heute unter 1.300€ nichts Brauchbares mehr zu finden. Mir erzählte ein Bekannter glaubhaft, dass er noch vor wenigen Jahren die ersten drei Monate mietfrei in Neukölln gewohnt habe, weil die Vermieter einfach niemanden fanden, der sonst dort hätte einziehen wollen.
Heute freilich, ist das anders. Heute muss man sich bereits lang und ausführlich für einen Besichtigungstermin bewerben. Die Daten, die die Vermieter hierbei erheben, übersteigen noch die kühnsten Träume von Steuerbeamten. Jedes Einkommen, jedes Auslandskonto, jede berufliche und mietrelevante Vergangenheit wird durchleuchtet. Selbst wenn es sich bei der Wohnung um eine nicht renovierte, geschweige denn lichtdurchflutete und von Gewürm befallene Studenten-Kaschemme im zweiten Hinterhof dubioser arabischer Großbasare handelt.
Sie stehen dann, so wie ich fast den ganzen regnerischen September, mit nassen Schuhen vor einer 60-Quadratmeterwohnung, die 130% ihres Studentengehalts an Miete verschlingen wird, in der es weder eine funktionierende Heizung, noch eine Einbauküche geben wird. Sie stolpern dann mit mindestens 70 anderen Bewerbern im 15 Minuten-Takt über die Füße der anderen, denn alle 15 Minuten kommen neue 70 Bewerber in die gute Stube und versuchen unter all dem Gewühl und unter den beschämten Blicken der vorher dort wohnenden, nicht gerade putzaffinen Studenten, einen Eindruck ihres hoffentlich zukünftigen Zuhauses zu erhaschen.
Aber dieser Wunsch ist in der Tat nur eine kühne Hoffnung. Denn die meisten Wohnungen gehen eine halbe Stunde nach dem ersten Besichtigungstermin an den Höchstbietenden. Das heißt an denjenigen, dessen Eltern das höchste und sicherste Netto-Einkommen unter den Bewerbern besitzen. Beamte und Lehrer vor, könnte man sagen. Aber auch Bürgschaften sind schon nicht mehr gern gesehen. Am liebsten sind den Vermietern eigentlich die Berufseinsteiger, am besten ein nettes Pärchen Anfang 30, die sich als doppelverdienendes Konglomerat nichts sehnlicher wünschen, als für 15€ den Quadratmeter in ihre spartanische Szenekiez-Abriss-Altbauwohnung zu ziehen. Auch wenn dann noch eine zusätzliche Bürgschaft der Eltern nötig sein sollte, weil die beiden in ihrer Work-Life-Balance das Life vor die Work stellen und somit der Lohn unter die Ausgaben fällt, drücken die Vermieter mal ein Auge zu. Auch der süddeutsche Migrationshintergrund wird dann schnell vergessen. Man ist ja weltoffen und sozial engagiert. Weshalb man auch immer wieder betont, die Wohnung eigentlich und vorrangig an junge Familien vergeben zu wollen. Solange sie zur autochtonen und bürgerlichen linksgrünen Lebenswelt gehören, sollte man noch dazusagen. Die syrische Großfamilie mit einem einzigen Verdiener und keinem süddeutschen Vermögen dahinter ist wohl weniger beliebt. So viele „arme und junge Familien“, denen die Berliner Vermieter gern ihre Wohnung zur Verfügung stellen wollen, gibt es daher gar nicht. Und daher muss sich der angestellte Makler eben doch durch die 789 Bewerbungsemails durcharbeiten, um einen passenden Sozialfall mit genügenden elterlichen Sicherheiten und einer ansehnlichen Erbmasse auszusuchen.
Man bewirbt sich also möglichst schnell per Email auf eine dieser Traumwohnungen „in einem aufstrebenden Umfeld“ und mit „guter Nachbarschaftsstruktur“ und erhält die schönste und befriedigendste Antwort auf seine Emails, die es nur geben kann: ein lautes, gellendes und über Wochen anhaltendes Schweigen. Auf Nachfrage wird man auch gern von den zuständigen Immobilienmaklern darüber informiert, dass man für das Versenden von Absagen keine Zeit mehr habe.
Und so hat man selbst genug Zeit, zuhause zu sitzen und zu verzweifeln. Neue Angebote kommen täglich nur 3-4 Mal auf die Onlineportale, dazwischen sitzt man da und überlegt, was man in seinen Bewerbungsunterlagen noch an „junger Student, low income, no wealth, sucht Wohnung mit bitte wenig Warmmiete, wie bei allen anderen auch“ optimieren könnte. Der ganze Tag ist gebunden. Man kann sich nicht entspannen. Entfernt man sich vom Computer, könnte ja das lebensrettende Angebot auftauchen, das außer mir niemand gesehen hat. Geht man an den Rechner, stirbt man vor Ungeduld und Langeweile. Es ist ein Teufelskreis. An den wenigen Ausnahmetagen, an dem man nicht vor dem Rechner sitzt, fährt man zu den Besichtigungsterminen und stellt sich in lange Schlangen ebenso im Marschtakt die Viertel abgrasender Wohnungsgeier. Irgendwann kennt man sich sogar. Man hat denselben Geschmack und anscheinend auch dasselbe Geld zur Verfügung, da es ja bei den anderen auch nicht zu klappen scheint.
Irgendwann, so nach zwei bis drei Wochen, ist man endgültig weichgeklopft. Man will einfach nur noch eine Wohnung. Wo sie liegt, ob es hineinregnet, ob die Nachbarn sich als Sympathisanten der Taliban herausstellen, all das wird nebensächlich. Man will nur noch diese quälende und nicht enden wollende Suche abschließen. Man will nie wieder auf Immobilienscout schlecht fotografierte Plattenbaualpträume nach Preis-Leistungs-Verhältnis sortieren müssen. Man unterschreibt am Ende mit bebender Hand und flehender Miene, als hätte einen der Vermieter vor dem Ertrinken gerettet, den viel zu teuren Mietvertrag und ist froh, noch das halbe Ikea-Mobiliar plus Katzenfutter des Vorgängers übernehmen zu dürfen.
Was ist nun das Fazit aus der Geschichte? Ziehen Sie in Berlin in den nächsten Jahren niemals um. Unser Berliner Senat hat nicht vor, an diesen traumhaften Verhältnissen schnell etwas zu ändern. Vielleicht ist das aber auch Berlins Beitrag zur Erziehung junger Menschen. Nach dem Wegfall der Wehrpflicht wird ja über ein soziales Pflichtjahr debattiert. Da geht Berlin wohl voran und führt schon mal ein paar Pflichtmonate in Sachen Geduldsprobe, Stressresistenz und Frustrationstoleranz ein. Wenn man es so sieht, kann man doch nur dafür sein, oder?
Der Beitrag erschien zuerst auf der Seite des Autors: Philosophische Auszeit.
Dieser Artikel spiegelt die Meinung des Autors, nicht der Organisation wider. Dieser Blog bietet die Plattform für unterschiedliche liberale Ideen. Du möchtest auch einen Artikel beisteuern? Schreib uns einfach eine Mail: redaktion@derfreydenker.de!
Mehr zur Organisation auf www.studentsforliberty.de.