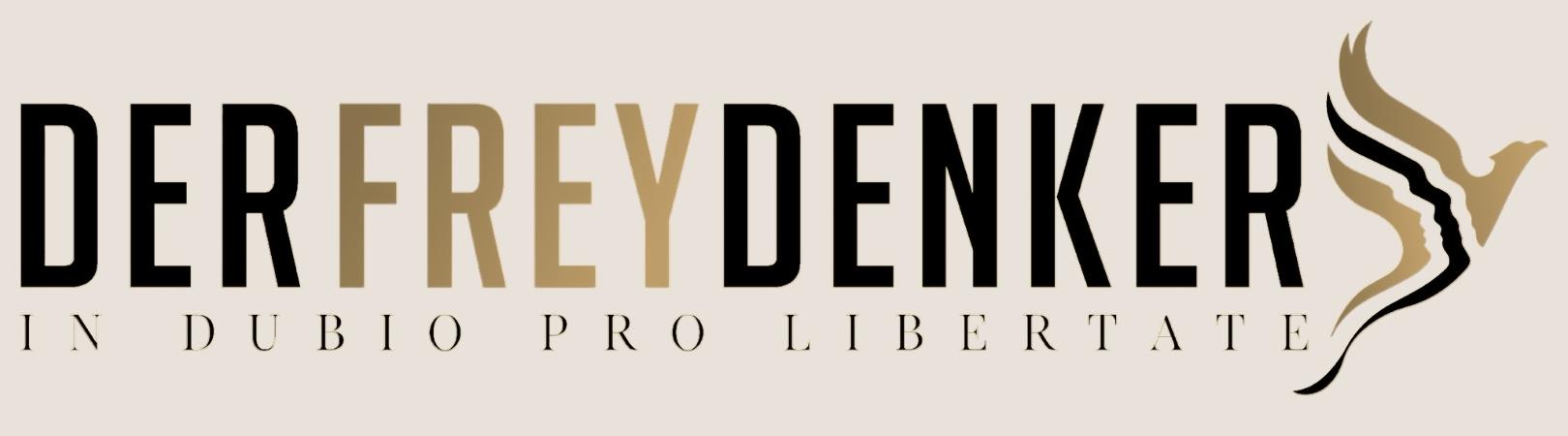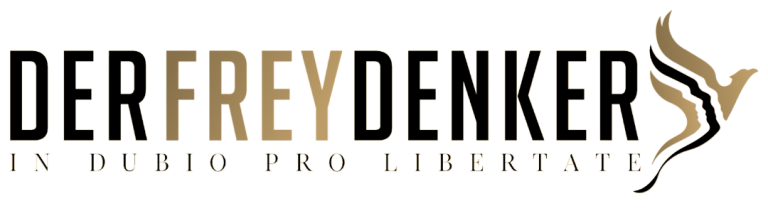Rauschmittel sind mehr für Clubs bekannt als in der Psychotherapie. Doch versprechen sie große Heilungserfolge bei Depressionen, der Posttraumatischen Belastungsstörungen oder Alkoholismus. Leider bremsen unbegründete moralische Vorbehalte die Medizinisierung und Forschung.
Beginnen wir mit Sigmund Freud und seiner Gewohnheit, gelegentlich zu koksen. Der Wiener Arzt und Begründer der Psychoanalyse sah in Kokain ein Wundermittel: Er selbst schätze die leistungssteigernde Wirkung des weißen Pulvers, seinen Patienten verordnete er es gegen Despressionen, Hysterie oder auch Morphiumsucht – mit mäßigem Erfolg. Statt seine Patienten zu heilen, litten sie infolge an einer Kokainabhängigkeit, einem schwachen Immunsystem und Schäden an Herz, Leber und Nieren. Außer vielleicht vom südamerikanischen Dschungel-Schamanen wird Kokain heute von keinem Arzt mehr verschrieben.
Anders sieht das bei Cannabis aus. Die Droge ist seit mittlerweile 4 Jahren ein offizielles Medizinprodukt und kann vom Arzt per Rezept verschrieben werden. Helfen soll es unter anderem bei chronischen Schmerzen, Multipler Sklerose oder Depressionen. Die Medizinisierung grenzt fast an einem Wunder, hört man auf die (un-)fachkundigen Statements der Drogenbeauftragten der Bundesregierung wie: „Cannabis ist illegal, weil es verboten ist“ – Marlene Mortler, Drogenbeauftragte 2014-2019; und „Cannabis ist kein Brokkoli“ – Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte seit 2019.
Als medizinisches Cannabis 2017 eingeführt wurde, prophezeiten Marktanalysten noch Jahr um Jahr neue Absatzrekorde, doch bleibt der Droge der große Durchbruch verwehrt: Während 2019 noch 44 Prozent mehr Cannabis als im Vorjahr verschrieben wurde, flachte das Wachstum 2020 mit nur noch circa 20 Prozent deutlich ab. Diese Entwicklung führen Experten auf vermeidbare Bürokratie zurück. Anders als bei gewöhnlichen Medikamenten muss die Cannabistherapie bei der Krankenkasse selbst von den Patienten beantragt werden. Die Behandlung wird nur finanziert, wenn eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt und der Patient keine therapeutischen Alternativen hat. Das lässt Ärzten und Krankenkassen genügend Spielraum, die Therapie im Zweifelsfall abzulehnen. Vermutlich fällt es einigen Ärzten schwer, Cannabis bei einer gewöhnliche Migräne zu verschreiben – so handelt es sich immer noch um eine Droge, die trotz erwiesenen medizinischen Nutzen weiterhin als Straßen- und Einstiegsdroge stigmatisiert wird.
Mit anderen Worten: unbegründete Vorurteile führen dazu, dass Patienten nicht mit der vollen medizinischen Palette an Möglichkeiten geholfen wird. Während Cannabis immerhin schon als Medikament zugelassen ist, sieht es bei „starken“ Drogen noch ganz anders aus. Ecstasy, LSD oder Zauberpilze versprechen Erfolge bei der Behandlung von Depressionen oder der Posttraumatischen Belastungsstörung, doch bleibt eine medizinische Verwendung wegen moralischer Vorbehalte aus. Sogar die Forschung wird verhindert.
Mit Ecstasy Traumata heilen
Ecstasy ist weit mehr in der Partyszene bekannt als in der Psychotherapie. Hinter der Droge verbirgt sich der Wirkstoff 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin, kurz MDMA. Gelangt dieser in den Körper, verfällt man in eine Art Glücksrausch: Die Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin und Dopamin schnellen im Blut in die Höhe.
Dieser Glücksrausch kann auch bei der Behandlung der Posttraumatischen Belastung (PTBS) helfen. Menschen mit dieser Krankheit leiden meistens jahrelang an den psychischen Folgen traumatischer Erfahrungen, wie zum Beispiel dem nahenden Tod auf dem Schlachtfeld, einem schrecklichen Autounfall oder sexuellem Missbrauch. Selbst nach mehreren Jahren können sie ihr Trauma nicht verarbeiten und sind geplagt von schlaflosen Nächte, leiden unter Angstzuständen und haben sogenannte Flashbacks – das sind blitzartige Rückblenden, bei denen die Betroffenen die Bedrohungssituation in Gedanken wiedererleben.
Konventionelle Therapien gegen PTBS sind häufig langwierig und schlagen nur selten an. Anders sieht das bei MDMA-assistierten Psychotherapien aus. Bei optimaler Dosis wurden bei den ersten Versuchen 86 Prozent der Patienten von der Krankheit geheilt. Die Therapie bestand aus zunächst 3 Gesprächssitzungen, bei denen der Patient die Therapeuten, bestehend aus jeweils einer Frau und einem Mann, kennenlernte. In der Sitzung vier, fünf und sechs erfolgte dann die Einnahme von MDMA in einer jeweils achtstündigen Session. Zum Abschluss begleiten die Therapeuten den Patienten dann noch mehrere Wochen.
Was macht MDMA gegen die Posttraumatisch Belastungsstörung so wirksam? Die Droge hilft, die traumatischen Situationen zu verarbeiten. Dafür ist es wichtig, dass Patient und Therapeuten über die schrecklichen Ereignisse sprechen und in die Situation hineingehen – was bedeutet, dass der Patient die Situation sowohl mental als auch und emotional wiedererlebt. Oftmals ist das mit einem großen Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust verbunden. Der Glücksrausch des MDMA hilft dem Patienten, den Schmerz erträglicher zu machen und mit den Therapeuten über die Situation zu sprechen. So kann das Trauma emotional und mental verarbeitet werden. Die israelische Produktion Trip of Compassion dokumentiert diesen Prozess.
Erst 2010 konnten die ersten Studien mit MDMA begonnen werden. Der Grund, warum nicht früher solche Versuche unternommen wurden, lag schlicht und ergreifend am Verbot der Substanz. Bis heute ist die Substanz illegal, doch drängten eine Vielzahl an PTBS erkrankter Soldaten die Genehmigungsbehörden dazu, endlich Pilotstudien zuzulassen. Federführend bei der Forschung ist die wissenschaftliche Vereinigung MAPS. In diesem Jahr soll die letzte Studie abschlossen werden, die die Wirksamkeit der Droge gegen PTBS final bestätigt. Fraglich ist, ob und wann die Droge dann als Heilmittel eingesetzt werden darf.
Zauberpilze und LSD helfen gegen Alkoholismus und Depressionen
Ähnliche Erfolge wie das MDMA bei Traumata verspricht auch LSD bei Depressionen und Alkoholismus. Mit LSD, kurz für Lysergsäurediethylamid, behandelt der Schweizer Psychiater Peter Gasser Patienten mit psychischen Krankheiten, bei denen keine andere Therapie anschlug. Gasser ist weltweit der einzige Arzt, der Patienten mit LSD behandeln darf. Laut eigener Aussage erzielt er damit große Erfolge.
Ein LSD-Trip innerhalb eines therapeutischen Rahmens kann dem Patienten helfen, tiefe Selbsterfahrungen zu machen, so Peter Gasser. Sowohl bei Alkoholismus als auch bei Depressionen können diese Erfahrungen den Betroffenen helfen, sich über das Ausmaß ihrer Sucht oder Traurigkeit bewusst zu werden. Das verschafft häufig einen anderen Blickwinkel, der Patienten hilft, den psychischen Ursachen ihrer Erkrankung auf den Grund zu gehen und somit die Symptome zu lindern oder gar aufzulösen.
Moderne Forschung zu LSD gibt es nicht. Die letzten Studien zu LSD entstanden in den 1960er Jahren. In genau diesem Jahrzehnt wurde die Substanz weltweit als verboten erklärt – folglich wurde auch offizielle Forschung untersagt. Dabei versprachen die fünfzig Jahre alten Studien große Heilerfolge bei Alkoholismus oder Depressionen. Doch interessierte Wissenschaftler aus der ganzen Welt können sich die Substanz zu Forschungszwecken nicht besorgen.
Umso überraschender ist es, dass ausgerechnet in Deutschland ab Januar 2021 mit der Forschung mit psychoaktiven Substanzen gegen Depressionen begonnen wurde. In Berlin und Mannheim werden therapieresistente Depressive mit Psilocybin – dem Wirkstoff aus sogenannten Zauberpilzen – behandelt, der ähnlich dem LSD wirkt. In der US-amerikanischen Stadt Denver wurden Zauberpilze wegen besagter Heilerfolge bereits entkriminalisiert.
Unbegründete Vorbehalte schaden der Forschung und damit den Patienten
Der Medizin sollte es ein moralisches Anliegen sein, Patienten bestmöglich zu helfen. Wenn Therapieformen verboten, Zulassungsverfahren von Behandlungen verzögert und moderne Forschung verlangsamt wird, dann wird diese ethische Pflicht verletzt. Das soll an dieser Stelle kein Vorwurf an Ärzte sein, sondern an die Menschen in den Gremien, die darüber entscheiden, ob Forschungen oder Medikamente zugelassen werden.
Menschen leiden absolut grundlos, wenn sie hilfreiche Substanzen nicht bekommen können. Dabei bieten begleitete Therapien durchaus einen sicheren Rahmen, in denen Patienten mit Depressionen oder PTBS eine bessere Zukunft ermöglicht wird. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das bald ändert.