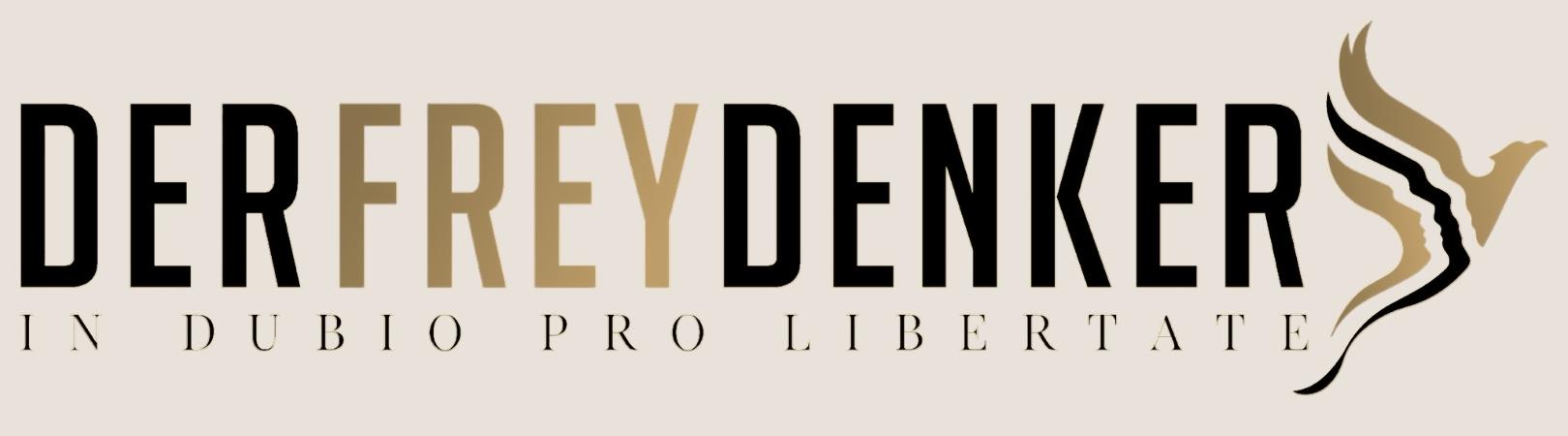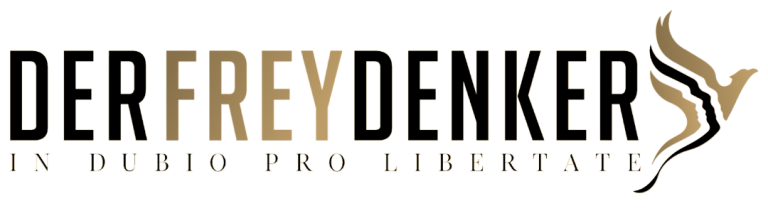Was haben Cristiano Ronaldo, „Harry Potter“-Schöpferin Joanne K. Rowling und Altbundeskanzler Gerhard Schröder gemeinsam? Alle drei haben es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Dank Fleiß, Talent und Ambitionen haben sie sich aus einfachen Verhältnissen zum Weltfußballer, an die Spitze der Bestsellerliste und ins mächtigste Amt im deutschen Staat emporgekämpft. Alle drei haben ihren Erfolg, so kann man sicherlich sagen, verdient – im Gegensatz zu allen Millionenerben und verhätschelten Juristentöchtern und Arztsöhnen. Oder etwa nicht?
Es gibt wenige Themen, bei denen sich Vertreter des gesamten politischen Spektrums in Deutschland einig zu sein scheinen. Und von diesen Themen wird wiederum auch nur ein Bruchteil tatsächlich öffentlich angesprochen, herrscht doch Einigkeit meist bei jenen Grundsätzen, über die man bereits stillschweigend übereingekommen ist. Eins dieser höchst seltenen Themen ist die Chancengleichheit.
Ich möchte nicht darauf hinaus, dass „Chancengleichheit“ einfach eine dieser Phrasen ist, die jeder hochhält, aber keiner ernst meint. Das ist sie durchaus – doch sie ist insofern ein Sonderfall, als alle ein relativ ähnliches Verständnis vom dahinterstehenden Konzept zu haben scheinen und auch bejahen. Das weithin anerkannte Versprechen der Chancengleichheit lautet: wenn jeder die gleichen Startbedingungen hat, die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten nicht von familiären Verhältnissen und anderen strukturellen Faktoren verzerrt werden, dann entscheiden allein Fleiß und Talent über den eigenen Erfolg. Wie könnte man auch etwas gegen diese wunderschöne Vorstellung haben?
Unser Gerechtigkeitsbegriff ist im Kern meritokratisch
Dem Dogma der Chancengleichheit liegt ein Gerechtigkeitsbegriff zugrunde, auf den sich beide Enden des politischen Spektrums geeinigt haben. Es handelt sich um einen meritokratischen Gerechtigkeitsbegriff. Das bedeutet, Ansprüche erwachsen in erster Linie aus Leistungen. Uneinigkeit herrscht nur mehr darüber, wie viel denn von wem geleistet wurde. Werden zum Beispiel die horrenden Gehälter von Wirtschaftsgrößen diskutiert, wird für und wider diese allein auf der Basis argumentiert, ob denn der Manager oder die Aufsichtsrätin wirklich das Vielfache des Saisonarbeiters leisten. Andere Erwägungen, beispielsweise in Millionengehältern das Nebenprodukt gesamtgesellschaftlich positiver Marktprozesse zu erkennen, fließen kaum in diese Debatte ein.
Genau dieses meritokratische Verständnis ist höchst problematisch. Es ist in sich nicht schlüssig und zudem gefährlich. Denn auch Fleiß und Talent sind keine Leistung, sondern Resultat einer Lotterie. Wer von großem Wuchs ist, wie Michael Jordan, hat ganz selbstverständlich erhöhte Chancen, einmal ein professioneller Basketball-Spieler zu werden. Aber der „Riese“ hat genauso wenig zu seiner angeborenen Größe beigetragen, wie die Tochter aus gutem Hause zum Portemonnaie ihrer Eltern.
Auch seine Arbeitsethik sucht man sich nicht wirklich aus – auch wenn das nach außen hin so scheinen mag. Wie hart man zu arbeiten gewillt ist, ist eher eine Frage der Disposition. Fleiß ist eine Charaktereigenschaft, die stark von Erziehung, Genetik und Prägung durch die Umwelt abhängt. Sie ist ebenso wenig von freier Entscheidung abhängig wie die Verhältnisse, in die man hineingeboren wird.
Worin besteht also der qualitative Unterschied zwischen diesen beiden unverschuldeten Startvorteilen? Es gibt ihn nicht. Vollkommene Meritokratie ist nur möglich, wenn wirklich alle Menschen unter absolut gleichen Bedingungen aufwachsen. Das bedeutet, alle müssen den selben Genpool haben, von den selben Erziehern großgezogen und von den selben Lehrern unterrichtet werden, die exakt selben Erfahrungen zur exakt selben Zeit machen und so weiter.
So unrealistisch diese Vision wäre, so wenig wünschenswert wäre sie auch. Es gäbe keine individuellen Unterschiede zwischen uns und unseren Mitmenschen, keine Unvorhersehbarkeiten, die unser Leben gefährlich aber überhaupt erst lebenswert machen, keine Arbeitsteilung, die unseren Wohlstand ermöglicht und unser Überleben sichert. Die totale Meritokratie mündet in einem totalen Egalitarismus und führt sich damit selbst ad absurdum.
Der freie Markt ist keine Meritokratie
Meritokratische Gerechtigkeit gerät aber auch in Konflikt mit der Marktwirtschaft. Und damit mit Wohlstand und Freiheit. Dabei haben selbst Verteidiger der Marktwirtschaft, die Erzählung verbreitet, in einem freien Markt könne jeder „es schaffen“ und die Besten würden entlohnt. Dass sich diese naive Annahme immer und immer wieder als falsch erwiesen hat, wird ihnen von ihren Gegnern zurecht vorgehalten. Die Marktwirtschaft ist keine Meritokratie – und das ist auch gut so.
Auf dem Arbeitsmarkt zählen Beziehungen fast immer mehr als die persönliche Eignung. Das erscheint ungerecht. Doch selbst, wenn wir annehmen, man könne die am besten geeignete Bewerberin nach objektiven Kriterien bestimmen, hat sie sich die Stelle nicht zwangsläufig eher „verdient“ als ihr Konkurrent, der mit dem Geschäftsführer verschwägert ist. Möglicherweise hatte sie Eltern, die sie von Geburt an intensiv gefördert haben oder hat bestimmte Qualifikationen in einer vorherigen Position erworben, die sie ihrerseits anhand von Beziehungen ergattert hatte. Außerdem ergibt es ökonomisch durchaus Sinn: wenn die Suchkosten für den „Perfect Fit“ zu hoch sind, ist es meist besser, einen Kandidaten zu nehmen, dessen Eignung „nur“ annehmbar ist, bei dem man aber immerhin nicht die Katze im Sack kauft.
Außerdem müssen Anreize bedacht werden. Wenn zehn Unternehmer mit einer nahezu identischen Geschäftsidee den Markt betreten, kann es durchaus vorkommen, dass sich einer der Zehn durchsetzt und zum Milliardär wird, während der Rest pleitegeht. Selbstverständlich spielt Glück dabei oft eine entscheidende Rolle und die erfolglosen Neun können ebenso wenig für das Ergebnis, wie ihr Rivale. Doch ohne die Aussicht auf die Risikoprämie in Form eines Milliardengewinns, hätte wohl keiner von ihnen einen Anreiz gehabt, der Welt seine Güter oder Dienstleistungen anzubieten.
Und ganz grundsätzlich sind die Ergebnisse von Marktprozessen weder vorhersehbar noch geradlinig. Sie sind zuweilen sogar hässlich. Doch im Gegensatz zur feudalen Ständeordnung oder zur sozialistischen Planwirtschaft bietet die freie Marktwirtschaft ihren Teilnehmern ein gewisses (natürlich begrenztes) Maß an individueller Lebensplanung und freier Berufswahl. Und sie ist das einzige System, das es den Verdammten dieser Erde auf breiter Front erlaubt hat und bis heute erlaubt, Armut, Hunger und Elend zu entkommen.
Zeit für Paradigmenwechsel
Es ist an der Zeit, sich von unserem meritokratischen Gerechtigkeitsbegriff zu verabschieden. Jedoch sollten wir ihn nicht einfach durch eine andere Definition von Gerechtigkeit ersetzen, die wieder nur versucht, Ethik auf abstrakte Prinzipien zurückzuführen. Viel eher müssen wir anerkennen, dass wir als Mitglieder der Gesellschaft versuchen, verschiedene Ziele zu erreichen und verschieden Maßstäben gerecht zu werden, die nicht immer eindeutig miteinander zusammenhängen.
Meines Erachtens ist die Meritokratie vor allem aus zwei Gründen für so viele attraktiv. Einerseits verspricht sie scheinbar Effizienz: wenn jeder die Position besetzt, für die er am besten geeignet ist, so die Vorstellung, dann maximiert das den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand. Andererseits wird sie von jenen idealisiert, die Mitgefühl haben mit jenen Unglücklichen, die trotz harter Arbeit nicht vorankommen, weil ihre Umstände sie daran hindern.
Wertschöpfung und Mitgefühl – beide Anliegen sind ernst zu nehmen. Doch darf man nicht den Fehler machen, sie allein im Lichte der Gerechtigkeit zu betrachten. Es gilt, zwei voneinander getrennte Fragen zu stellen: Wie ermöglichen wir die Erschaffung von größtmöglichem Wohlstand? Und: Wie helfen wir am besten denen, die sich nicht selbst helfen können?
Eine meritokratische Ordnung bietet nur scheinbar eine Antwort auf diese Fragen. Sie ist weder umsetzbar noch in ihrer Reinform wünschenswert. Sie gefährdet den Wohlstand, anstatt ihn zu mehren und schränkt die Menschen in ihrer Freiheit ein. Wir sollten uns also der unangenehmen Wahrheit stellen, dass Meritokratie in einer wohlhabenden und freien Gesellschaft ein Luftschloss bleiben muss.
In Debatten über Vermögensverteilung und andere gesellschaftliche Streitpunkte sollten wir weniger über Moral und mehr über konkrete Fragen wie diese diskutieren. Das bedeutet nicht, die Moral aus diesen Debatten zu verbannen. Aber wir müssen aus moralischen Erörterungen konkrete Ziele kondensieren und uns darüber unterhalten, wie wir diese erreichen, anstatt bei den Moralfragen zu verharren. Unsere Diskussionskultur wird es uns danken.