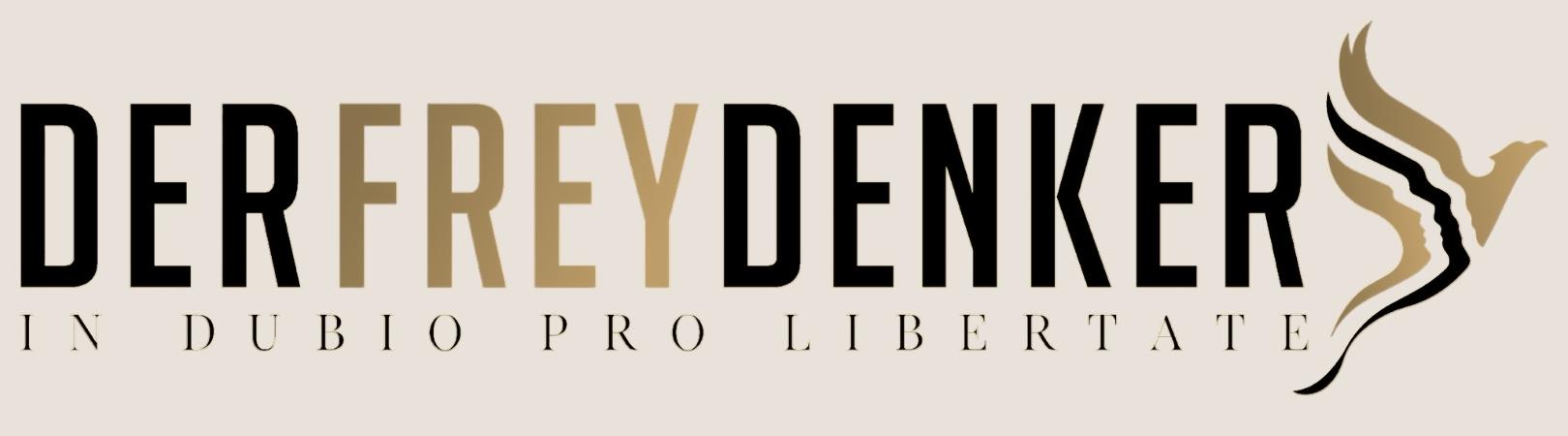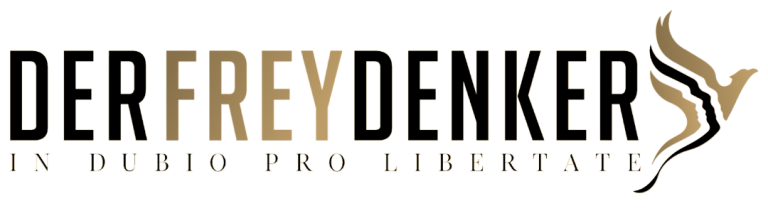Aus unserem Print-Magazin: Der Ordoliberalismus ist der vielleicht bedeutendste Beitrag deutscher Ökonomen zur Wirtschaftswissenschaft. Prof. Stefan Kolev führt aus, was die zentrale Idee der Denker um Walter Eucken war und welche Bedeutung das Denken in Ordnungen noch heute hat.
Das Interesse an der politischen Ökonomie des Ordoliberalismus ist in den vergangenen 15 Jahren sprunghaft angestiegen. Bücher zur Geschichte und Aktualität dieses Forschungsprogramms werden in den renommiertesten internationalen Verlagen veröffentlicht, die verschiedenen Sozialwissenschaften diskutieren in ihren Zeitschriften den „langen Schatten“ der Freiburger Schule um Walter Eucken und Franz Böhm oder ihrer Weggefährten Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow und Alfred Müller-Armack. Während die internationale Diskussion zu Beginn mit der speziellen deutschen Position in der Fiskal- und Geldpolitik während der Finanzkrise zu tun hatte, kann man sich heute des Eindrucks nicht erwehren, dass unsere Zeit und der Ordoliberalismus etwas verbindet, das sich in diesem Essay „Fragilität“ nennen will.
Bevor wir zur Aktualität kommen, ein geschichtlicher Abriss der ordoliberalen politischen Ökonomie. Weil die meisten Leser dieses Magazins mit der Geschichte der Österreichischen Schule vertraut sind, wähle ich die Österreicher als Ausgangspunkt. Die Ordoliberalen hatten nicht die – in der Theoriegeschichte sowieso fast einmalig langen – 150 Jahre Entwicklung der Österreicher; stattdessen entstand das Forschungsprogramm in den 1930er und 1940er Jahren, während die nachfolgenden ordoliberalen Generationen es nicht schafften, das Programm wesentlich fortzuentwickeln. Gerade die 1930er und 1940er Jahre sind aber eine besonders aufschlussreiche Zeit, um die Ordoliberalen in Bezug zu Hayek und Mises, den meist rezipierten Österreichern, zu setzen. Die Ordoliberalen und Hayek, der eine spannende Zwischenstellung zwischen den Österreichern und den Deutschen einnimmt, fanden die Mises’sche Sozialismus-Kritik überzeugend, nicht aber seine Interventionismus-Kritik. Letztere warf für Eucken, Röpke und Hayek die zentrale Frage auf, ob es „gute“, also systemnotwendige Interventionen gibt, die vor allem eine Sache verhindern sollen: den Zusammenbruch der Ordnung, der sich vor ihren Augen in Mitteleuropa ereignete.
Die Ordnungstheorie als Suche nach robusten Formen für Wirtschaft und Gesellschaft und die Ordnungspolitik als die Gestaltung solcher Formen zielen gerade darauf ab, nicht nur dem freien Spiel der Privaten gute Spielregeln zu geben, sondern auch den Zusammenbruch des Spielfeldes – wie 1917 in Russland oder 1933 in Deutschland – zu verhindern. Die Wirtschaft wird dabei als Teilordnung der Gesellschaft verstanden, die in interdependenten Bezügen zu den übrigen Teilordnungen wie dem Recht, dem Staat oder der Wissenschaft steht. Durch diese Interdependenz der Ordnungen vermag die Wirtschaft Signale auszusenden, wie es in der Großen Depression geschah, welche die gesamte Ordnung der Gesellschaft zerstören können.
Dabei vollzogen die Ordoliberalen und Hayek eine doppelte Wendung. Zum einen verabschiedeten sie sich von der Analyse der Wirtschaft mittels des Begriffes des (Un-)Gleichgewichts, der zuvor bei der Konjunktur- und Kapitaltheorie im Vordergrund gestanden hatte, als es um die – wie sich herausstellte, vergebliche – Bekämpfung der Depression ging. Statt des (Un-)Gleichgewichts rückten sie den Begriff der (Un-)Ordnung in den Mittelpunkt, was mehr als nur semantische Konsequenzen hatte: Eine auf (Un-)Gleichgewicht beruhende Ökonomik, die man „isolierend“ nennen kann, beschäftigt sich vor allem mit den Prozessen innerhalb der Wirtschaftsordnung. Eine auf (Un-)Ordnung beruhende Ökonomik hingegen kann man „kontextual“ nennen: Sie denkt die Wirtschaftsordnung besonders in ihren Schnittstellen zu den übrigen gesellschaftlichen Teilordnungen. Die zweite Wendung war, dass die Ordoliberalen und Hayek sich gerade in den 1940er Jahren nicht mehr lediglich als Erforscher verschiedener positiver Ordnungen verstanden, sondern auch explizit als Verteidiger einer normativen Ordnung. Die gut geordnete Wirtschaft dieser Ordnung wird von Eucken, Röpke und Hayek, aber auch von der „Old Chicago“-Schule um Henry Simons und Frank Knight, als „Wettbewerbsordnung“ bezeichnet.
Die politische Ökonomie des Ordoliberalismus stellt dabei eine zentrale Frage, die ich mit dem Begriff „Statik“ überschreiben will. Es geht um die Suche nach den Voraussetzungen für eine funktionsfähige und menschenwürdige Wirtschaftsordnung – nach Regeln, die den Ordnungsrahmen ausmachen, welcher eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit ermöglicht. Das Programm lässt sich mit dem Motto „laissez-faire within rules“ treffend zusammenfassen. Für die lange Tradition der Österreicher von Carl Menger bis Israel Kirzner und Peter Boettke ist hingegen die Dynamik der Marktprozesse, die sich innerhalb des im Vergleich dazu statischen Ordnungsrahmens abspielt, von größerer Faszination. Damit befinden sich die Ordoliberalen und die Österreicher in einer impliziten Arbeitsteilung, die gerade im Werk Hayeks auf besondere Art zusammenfließt.
Und damit wären wir bei der Aktualität der Ordoliberalen. Denn wenn man auf die letzten 15 Jahre zurückblickt, so sieht man zum einen kumulative Krisen: von der Finanz- und Euro-Krise über die Ukraine-, Flüchtlings- und Brexit-Krise bis zur Klima- und der Corona-Krise. Heutige Studierende kennen ihre soziale Realität nur in diesem Krisen-Modus. Zum anderen befähigt der hier umrissene ordoliberale Ansatz einer kontextualen Ordnungsökonomik zur Diagnose, dass wir seit der Finanzkrise in Ordnungen leben, die vor allem eines sind: zunehmend fragil. Diese Fragilität entsteht durch die krisenhaften Impulse, welche die einzelnen Teilordnungen – national und international – aneinander senden.
Die dynamischen Marktprozesse werden jüngst wegen der Kombination aus Globalisierung und Digitalisierung von zunehmend vielen Bürgern, gerade in den westlichen Demokratien, im Vergleich zu früheren Jahrzehnten als „zu dynamisch“ wahrgenommen. Das birgt für die Legitimität der Ordnungen enorme Gefahren, denn eine solche Wahrnehmung von „zu dynamisch“ kann leicht in „chaotisch“ umkippen: Ab diesem Zeitpunkt nimmt der Bürger die Ordnung nicht mehr als solche wahr und entzieht ihr die Legitimität. Das ist das Ende einer Ordnung, deren Legitimität aus subjektivistischer Sicht mit den Wertbeziehungen vergleichbar ist, die der Werttheorie der Österreicher zugrunde liegt.
Falls diese Diagnose zutrifft, ist es naheliegend, bei der Therapie der als „zu dynamisch“ wahrgenommenen Ordnungen nach Statik zu suchen. Ich nenne diese Statik „Fixpunkte“ und meine damit glaubhaft kommunizierte Stützen, die in der subjektiven Wahrnehmung des Bürgers dazu führen, dass die Ordnung Ordnung bleibt und sie einen weder kognitiv noch existenziell überfordert. Beispiele für solche Fixpunkte sind auf dem Gebiet der Sozialpolitik Bildungsgutscheine, die der Angst entgegenwirken, durch die Digitalisierung das eigene Humankapital plötzlich entwertet zu sehen. Auf dem Gebiet der Digitalisierung wiederum, bei der auch nicht gewährleistet ist, dass wir sie als menschenwürdige Teilordnung unseres Lebens sehen, wären zum Beispiel das Recht auf digitales Vergessenwerden und auf Datenportabilität zwei Fixpunkte, die ein Mindestmaß an Autonomie durch Wettbewerb als Entmachtungsinstrument der Tech-Konzerne gewährleisten.
Die Ordoliberalen haben vielleicht klarer als andere Liberale, auch als bestimmte Vertreter der Österreichischen Schule, die Gefahr gesehen, dass die liberale Gesellschaft der Moderne durch ihre dynamischen Prozesse – trotz allen damit verbundenen freiheitlich-emanzipatorischen und materiellen Fortschritten – auch viele Ängste, Unbehagen und Unsicherheit mit sich bringt. Diese Gesellschaft hat die Fixpunkte selbst zu gewährleisten und damit jedem Bürger helfen, mit der Dynamik klarzukommen, statt bei Härtefällen auf vormoderne Gemeinschaften wie die Familie oder die lokale Gemeinde zu appellieren. Die Freiheit wird im Verständnis der Ordoliberalen nur von Bestand sein, wenn es Bürger und Wissenschaftler – in einem arbeits- und wissensteiligen Prozess – schaffen, sich Ordnungsrahmen zu geben, die dahingehend menschenwürdig sind, als sie Lernen und Adaptation an den Wandel ohne Überforderung ermöglichen. Ob die heutigen Ökonomen in ihrem Selbstverständnis diese Rolle des Bürgerberaters einnehmen wollen und können, wird für das Fortbestehen unserer fragilen Welt nicht unerheblich sein.