Die berühmt-berüchtigten „Robber Barons“ haben rücksichtslos ihr Eigeninteresse verfolgt und mussten durch den Staat gestoppt werden?! Wie Burton W. Folsom, Jr. in The Myth of the Robber Barons zeigt, ist die Geschichte viel vertrackter.
Wie wir die Vergangenheit sehen, nimmt großen Einfluss darauf, wie wir in die Zukunft schreiten. Die Geschichte der amerikanischen „Robber Barons“ ist so ein Blick auf die Vergangenheit, der beeinflusst, wie wir zukünftig unser Land gestalten. Gerade deshalb ist Folsoms Buch so lesenswert, zeigt es doch, dass es sich bei den Räuberbaronen um einen Mythos handelt, der in gefährlicher Art und Weise die Geschichte verzerrt.
Selbst wenn einem der Begriff der „robber barons“ bisher noch nicht begegnet ist, ist die Schlagrichtung klar. Es handelt sich hier um eine Gruppe von Menschen, die in moralisch verwerflicher Manier andere beraubt und sich dabei wie Feudalherren geriert haben. Diese Menschen mögen in ihrem Metier herausragend gut gewesen sein, aber es ist doch notwendig, ihre Machenschaften einzuhegen, um die Gesellschaft vor ihrem sinistren Wirken zu schützen.
So weit so gut. Das Problem mit dieser Geschichte ist nur, dass diejenigen, die weithin als „robber barons“ verschrien wurden, gerade nicht die räuberischen Feudalherren waren. Im Gegenteil. Wie Folsom aufzeigt, gibt es zwei unterschiedliche Typen von Unternehmern. Auf der einen Seite sind da die „market entrepreneurs“, die sich durch Innovationskraft, die Bereitschaft und das Bestreben, stets Kosten zu senken sowie ihre generelle Kompetitivität auszeichnen. Auf der anderen Seite finden sich die „political entrepreneurs“, deren Hauptaugenmerk das Einspannen des Staates zum eigenen Vorteil ist. Während die „market entrepreneurs“ eine positive Kraft in der Wirtschaft sind, die zum Wohle der Konsumenten wirkt, sind es die „political entrepreneurs“, welche Korruption, Misswirtschaft und Wohlstandsverlust verursachen.
Das Problem oder der Mythos an den Räuberbaronen besteht nun darin, genau jene, die sich im freien Wettbewerb durchgesetzt haben, als „robber barons“ zu bezeichnen – und nicht oder zumindest nicht ausschließlich die politischen Unternehmer, deren Kalkül darauf ausgerichtet gewesen ist, mittels des Staates Kasse zu machen. Dabei sind es die fälschlich als Räuberbarone titulierten „market entrepreneurs“, welche mit ihrem ruchlosen Wettbewerb die Kosten senken und den Kunden den bestmöglichen Preis anbieten. Diejenigen also, denen die große Masse der Menschen ihren Wohlstand verdankt, werden als Räuberbarone beschmiert. Dabei waren die wahren Räuberbarone jene, die mit staatlichem Zwang an den Konsumenten vorbei ihren Profit machten.
Folsom beschreibt in sehr lesenswerter Art und Weise, wie das vonstattenging. So erzählt er etwa von Cornelius Vanderbilt, der in der Schifffahrt tätig war. So musste sich der „market entrepreneur“ Vanderbilt gegen einen Rivalen behaupten, der jährlich 858.000 US-$ an Subventionen einstrich – nichtsdestotrotz setzte sich Vanderbilt durch, indem er innovierte, sich an den Kunden ausrichtete und stets gewillt war, neue Wege zu gehen. Und dennoch gilt Vanderbilt heute als Räuberbaron, obwohl er es war, der sich ohne politische Gefälligkeiten behauptete.
Eine wichtige Erklärung, die Folsom auch anschneidet, ist ein ökonomisches Missverständnis. So entstand und besteht immer noch die Überzeugung, dass Monopole oder zumindest sehr große Unternehmen per se schlecht seien. Gerade das ist aber nicht der Fall, geht es doch darum, dass Unternehmen sich wettbewerblich verhalten und Konsumenten den günstigsten Preis bieten. Und genau das kann durch Größe in manchen Fällen besser erreicht werden. Folsom bemerkt über den zu seiner Zeit reichsten Mann der Welt, John D. Rockefeller: „Bigness was not Rockefeller‘s real goal. It was just a means of cutting costs“. Rockefeller hatte mit Standard Oil einen Ölgiganten erschaffen, der später dann – zum Leid der Bürger – durch den Staat zerschlagen wurde.
Dies geschah unter dem sogenannten Sherman Antitrust Act, den die USA 1890 verabschiedeten. Dieser schloss sich an frühere Versuche der Bundesstaaten an, in die Wirtschaft einzugreifen. Dies geschah wohl aus dem Grund, einige Produzenten vor überlegener Konkurrenz zu schützen – zulasten des Konsumenten, wie Di Lorenzo zeigt. Und hier zeigt sich, dass Folsoms Text über die Beleuchtung der „robber barons“ hinaus von Bedeutung für die Ökonomik ist. Folsoms Studie illustriert das Scheitern des Staates als Regulierer der Wirtschaft, als Unternehmer wie auch als Subventionsgeber.
Folsom schließt sein kurzes, aber knackiges Buch mit einem Verweis auf die Philanthropie der „market entrepreneurs“. Die meisten dieser Unternehmer sahen sich in Positionen, die mit großer sozialer Verantwortung einhergingen und die sie mit großer Ernsthaftigkeit erfüllten. Diese schloss aber auch ein, nicht wahllos Almosen zu verteilen. „They sympathized with the needy, but supported only those needy imbued with the work ethic”.
The Myth of the Robber Barons ist ein äußerst lesenswertes Buch. Folsoms Werk bietet eine unterhaltsame Lektüre, die mit einigen kuriosen Geschichten aufwartet, durch die Korrektur eines viel zitierten Mythos gleichzeitig aber von zeitloser Relevanz ist.
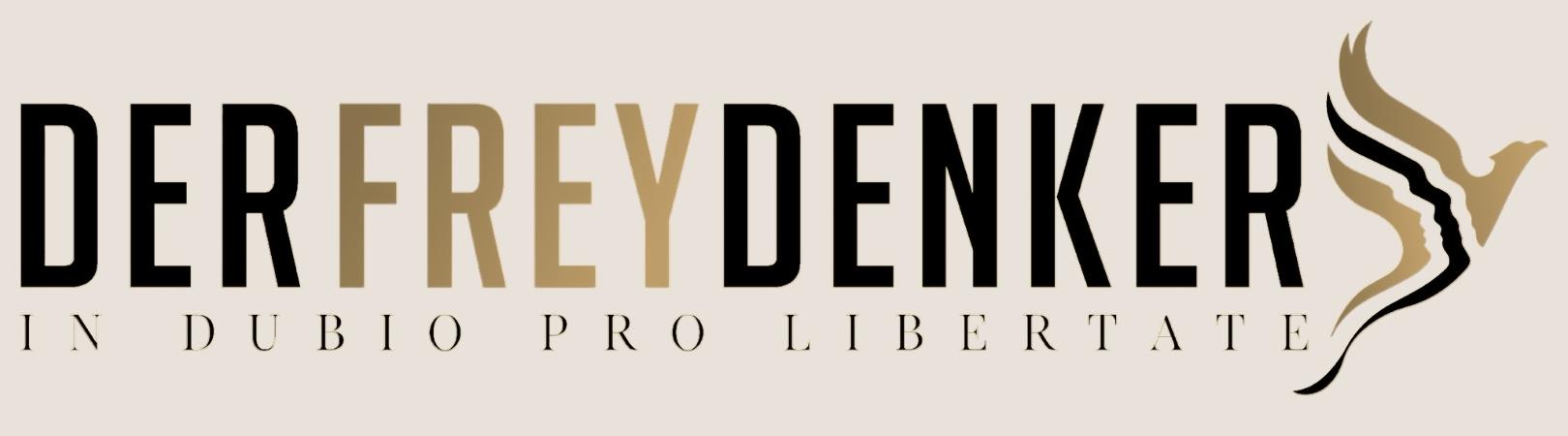
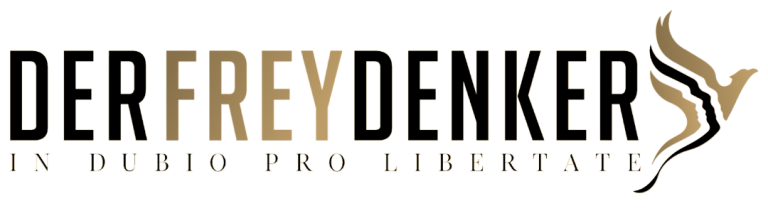
2 Kommentare
Große Unternehmen sind natürlich nicht per se schädlich, Monopole aber sind es schon! Allerdings entstehen auf einem freien Markt niemals stabile Monopole, d.h. Monopolisten sind immer „political entrepreneurs“, niemals „market entrepreneurs“.
Aber danke für den Buchhinweis, scheint interessant zu sein.
Hallo Jana, danke für Deinen Kommentar! Ich glaube, du bist hier einem grundsätzlichen Missverständnis aufgesessen. Ein Monopol meiunt nur, dass es lediglich einen Anbieter gibt. Dieser kann aber in einem harten Wettbewerb stehen und wettbewerblich agieren, sodass es keinen Monopolpreis gibt. Die Konsumenten wiederum können sich explizit für Produkte dieses Monopolisten entscheiden und so insgesamt das beste Angebot erhalten. Würdest du nun aber Monopole aufbrechen wollen, würdest du gerade den Konsumenten schaden, da du ja die effiziente Bereitstellung des Gutes verhinderst und in den Wettbewerb eingreifst. In anderen Worten, es geht um Wettbewerb, nicht darum, wie viele Unternehmen als Resultat dieses Wettbewerbs in einer Branche unterwegs sind. Deswegen ist entscheidend, dass es keine „barriers to entry“ gibt.
Das Buch ist aber so oder so empfehlenswert.